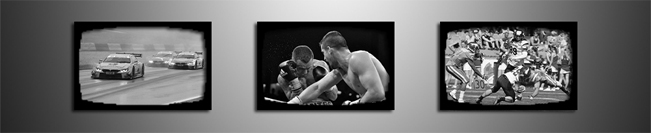Bei der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei musste Österreich wieder im Aufzug Platz nehmen. Nach der blamablen Weltmeisterschaft geht es im kommenden Jahr wieder in der B-Gruppe um Punkte, Siege und Prestige. Ist der Abstieg ein „Betriebsunfall“ oder liegen die Hintergründe „tiefer“?
Werfen wir einen Blick auf die großen Baustellen des heimischen Eishockey-Sports! Ein Kommentar von Thomas Muck.
Die Vorzeichen für die Weltmeisterschaft in der Slowakei standen für das Team Österreich eigentlich nicht schlecht. Mit Michael Raffl hatte Teamchef Roger Bader einen NHL-Spieler zur Verfügung. Bis auf Michael Grabner, Andreas Kristler (beide Oberkörper), sowie Brian Lebler und Stefan Ulmer (beide Unterkörper) konnte damit Teamchef Roger Bader die besten verfügbaren Spieler setzen. Thomas Vanek wird wohl nicht mehr für das Nationalteam auflaufen und war auch keine realistische Option.
Man sollte den Abstieg einfach „irgendwie verhindern“. Mit Italien war der Hauptgegner rasch ausgemacht. Die „Azzurri“ sind, trotz aller Sympathien, mit diesem Kader keine A-Nation gewesen. Die vermeidbare Niederlage nach Penaltyschießen gegen Italien hat nun alle eines Besseren belehrt. Österreich muss den bitteren, in Wahrheit aber verdienten Gang in die B-Gruppe antreten. Die Baustellen sind allgegenwärtig. Manche betreffen die Spieler, einige den Verband, die meisten aber die Liga.
Werfen wir einen Blick darauf.
Fehlende Kadertiefe, Leistungsträger mit Formschwankungen schwächen das Team doppelt
Der Pool an „difference maker“ im heimischen Eishockey ist überschaubar. Sowohl im Angriff, aber besonders in der Verteidigung. Wenn designierte Scorer wie die Raffl-Brüder oder EBEL-MVP Peter Schneider ihre „überschaubare Form“ aus dem Verein ins Nationalteam mitnehmen, fehlt ein unersetzbarer Mosaikstein für das gesamte Mannschaftsgefüge. Sprich in den Schlüsselrollen fehlt die Tiefe oder keiner aus dem vorhandenen Kader war dazu in der Lage, in der entscheidenden Phase diese Rolle auszufüllen.
Deutlich schwerwiegender scheinen die Ausfälle in der Verteidigung für das Team Österreich. Im internationalen Vergleich hochwertige Offensivverteidiger mit einem ausgeprägt hochqualitativen Passspiel sind generell Mangelware und die vorhandenen Spieler waren meilenwert von ihrer (für eine A-WM benötigte) Hochform entfernt.
Taktische Ordnung – Mangel in der taktischen Grundausbildung?
Im Vorfeld des Spiels gegen die Schweiz waren sich die TV-Experten im Lager der Eidgenossen einig. Wenn die Mannschaft den „Turbo zünden würde“ und die „Verteidiger sich in das Angriffsspiel einschalten, wird die Defensivordnung bei den Bader-Boys verloren gehen“. Selten war eine Analyse so zutreffend wie diese! Die ÖEHV-Auswahl verlor gegen die großen Nationen sehr häufig die defensive Ordnung in der eigenen Zone. Dafür reichte es in der Regel meist an der Temposchraube zu drehen! Eine Entwicklung, die es bei der letzten WM noch nicht gab!
Vermeidbare Fehler
Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Eishockey-Saison 2018/19 – die vermeidbaren Fehler! Gegentore entstehen entweder nach außergewöhnlichen Einzelleistungen oder durch vermeidbare Fehler! Bei der WM in Bratislava unterliefen den Nationalspielern in Wahrheit deutlich zu viele Fehler! Diese gilt es in der näheren Zukunft so rasch wie möglich abzustellen. Diese „vermeidbaren Fehler“ führen in der Regel zu „billigen Gegentoren“. Die Katze beißt sich sportlich in den Schwanz.
Schlussmänner mit wenig Spielpraxis – Heimat suchst du großartige Goalies
Der Pool an qualitativ hochwertigen Goalies in Österreich ist überschaubar. Genauso deren Einsatzzeit. Egal ob David Kickert (Linz), Bernhard Starkbaum (Wien) oder Lukas Herzog (Salzburg). Alle haben es mit einem Import-Goalie zu tun, der Stammkraft im Verein sind. Generell ist die Spielzeit heimischer Goalies im internationalen Vergleich erschreckend gering. Lediglich 23,2 Prozent der Spielzeit gehen an potentielle Nationalspieler. Zum Vergleich: Schweiz: 85,9, Finnland 84,6, Schweden 81,9 oder Russland 58,6 Prozent. Sprich: Vorhandene Quantität erhält qualitativ wenig Spielzeit. Die Abwärtsspirale ist definitiv haus- bzw ligagemacht!
Nachdem seit gestern alle Ligen beendet sind: Die aktuellen Daten für 2018/19; Spielanteile (auf Basis Time-on-Ice) "einheimischer" Torhüter in den acht wichtigsten Ligen Europas (Regular Season plus Play-Offs ohne eventuelle Relegationen). pic.twitter.com/WpPzLRN4Lx
— Hannes Biedermann (@HannesBied) 5. Mai 2019
Verteidiger – ein seltenes, meist umgeschultes Gut
Ein Königreich für einen gelernten Verteidiger! Wenn dieser einen österreichischen Pass besitzt und Offensivqualitäten besitzt, ist er entweder ein umgelernter Stürmer oder ist im Spätherbst seiner Karriere (Beispiel: Andre Lakos) und somit für das Nationalteam kein Thema mehr. Der heimische Markt an geeigneten Verteidigern ist in Wahrheit sehr überschaubar. Keine 20 Kandidaten duellieren sich um die 8 Kaderplätze für die WM. Alternativen für das Team Österreich sowohl auf Seiten der Defensiv- wie auch Offensivverteidiger sind in Wahrheit kaum vorhanden. „Aktive Umschulungen wie zuletzt bei Setzinger (Graz) oder Fischer (Capitals) kaschieren das eigentliche Grundproblem! Es kommen kaum Verteidiger an der Spitze des heimischen Eishockey an.
Wo war der Speed – verzweifelte Suche nach dem 2. Gang
Österreich kann sich von einem Trend nicht abkoppeln. Eishockey wird immer schneller! Nicht nur die Schnelligkeit der Spieler am Eis, sondern auch die Schnelligkeit und die Qualität der Entscheidungen wird von immer höherer Priorität. Die WM in Bratislava hat eines eindrucksvoll bewiesen, dass die österreichischen Spieler sind im internationalen Vergleich zu langsam. Sowohl in den Beinen, aber auch im Kopf!
Einstellung/Lernbereitschaft
Bei der A-WM hört man gebetsmühlenartig zwei Phrasen: „Lernspiel“ bzw. „Entscheidungsspiel“. Gegen Giganten wie Russland oder Schweden will man „lernen“. Diese Erkenntnisse soll dann im „Entscheidungsendspiel“ umgesetzt werden. Soweit der „Plan“. Bei allem gegebenen Respekt vor Teams wie Italien, aber in allen Aspekten ist Österreich die bessere Mannschaft. Wenn man aber die „eigenen sportlichen Qualitäten“ nicht umsetzen kann, die eigenen Nerven nicht im Griff hat, und gleichzeitig den Gegner durch vermeidbare Fehler stark macht, dann darf man erwarten, dass man praktisch „Dauergast im Aufzug zwischen A- und B-Gruppe“ ist.
Gleichzeitig gilt es die Einstellung zu hinterfragen. Anstelle, dass man Teams, die in etwa auf Augenhöhe sind, in Richtung „Sensation“ denkt, macht man sich kleiner als man ist. Zusätzlich werden im Laufe des Turniers gemachte Fehler wiederholt und nicht abgestellt. Ein Trend, der seit Jahren anhält und einen nachdenklich stimmen muss.
Vereine vertrauen heimischen Perspektivspielern nicht
Im Vorfeld der WM war Raphael Wolf nur sehr genauen Beobachtern der Erste Bank Eishockey Liga ein Begriff. Der 23-Jährige absolvierte 43 Grunddurchgangsspiele und steuerte ein Tor und einen Assist bei. Überschaubare Zahlen, aber hatte er die Möglichkeit sich aufzudrängen? Nein! Ein Wert von 0 in der Plus/Minus-Wertung bei 16 Strafminuten lassen aber sein Potential erahnen. Der knapp zwei-Meter-Hüne besitzt Gardemaße für einen Defender. Wenn ihm aber der eigene Trainer nicht vertraut, ihm wenig Eiszeit gibt, fallen solche Spieler durch den Rost. Das Beispiel Raphael Wolf zeigt eindrucksvoll, dass Qualität auf dem Segment der heimischen Spieler durchaus vorhanden ist. Wenn Vereine und Trainer diesen Akteuren nicht vertraut, geht die Abwärtsspirale im heimischen Eishockey in diesem Segment weiter.
Jedes EBEL-Team ist ein Aus- und Weiterbildungsverein, ob es will oder nicht!
Die Saison 2018/19 bei den Vienna Capitals hatte einige interessante Personalien. Legen wir den Fokus auf drei Spieler. Eine Grundsatzfrage: Was haben Benjamin Nissner, Peter Schneider und Chris DeSousa gemeinsam? Sie haben den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung gemacht. Aus dem „unwesentlichen Rollenspieler“ Benjamin Nissner wurde ein verlässlicher Center-Stürmer. Die beiden letztgenannten drängten sich mit bärenstarken Leistungen für die europäischen Top-Ligen Finnland und Schweiz auf. Auch wenn es die Fans des Vize-Meisters nicht gerne hören, die Vienna Capitals sind ein internationaler Aus- und Weiterbildungsverein!
Aber ist das bei allen Vereinen so? Teams wie die Dornbirn Bulldogs, HC TWK Innsbruck oder der VSV arbeiteten in der jüngeren Vergangenheit für den kurzfristigen, in der Regel ausbleibenden, sportlichen Erfolg. Mittel- oder gar langfristiges Konzept war und ist keines erkennbar. Besonders bei den Adlern scheint dieser Trend ärgerlich. Eine Nachwuchsabteilung, welche mit Michael Grabner und Michael Raffl zwei aktuelle NHL-Spieler stellt, derart zu vernachlässigen darf getrost als „äußerst leichtsinnig“ bezeichnet werden.
Dementsprechend ist eines klar: Jeder Verein in der Liga sollte sich seiner Funktion im nationalen, wie auch im internationalen, Bereich klar werden. Die Teams der Erste Bank Eishockey Liga sind Aus- und Weiterbildungsvereine! Diesen Umstand könnten die handelnden Personen am Ende des Tages durchaus als Eigen-PR nutzen. Ein Blick über den Tellerrand würde Augen öffnen.
Langfristige sportliche Konzepte
Wer die Teams der Erste Bank Eishockey Liga betrachtet wird feststellen, dass kaum mittelfristige bis langfristige Konzepte vorhanden sind. Weder im Nachwuchs, noch im Bereich der Kampfmannschaften. Alles was über eine Saison hinausgeht ist weder auf dem ersten, noch auf den zweiten und schon gar nicht auf den dritten Blick erkennbar. Somit fehlt es auch an Perspektiven für Nachwuchsspieler. Wer glaubt, dass Nachwuchsspieler nicht über „spezielle zukünftige Aspekte nachdenken“, wird vermutlich auch daran glauben, dass die Erde flach ist.
Auswahl der Trainer
Ist Teamchef Roger Bader nun der „beste Teamchef aller Zeiten“ oder die „Ideallösung für die aktuelle Lage“? In Wahrheit fällt die Antwort wie folgt aus: Weder noch! Roger Bader ist aber ein Trainer der ein Konzept besitzt, dieses durchzieht und für Spieler und die Öffentlichkeit „authentisch“ bleibt! Ist dies in der Erste Bank Eishockey Liga der Fall? Nein! Der kurzfristige sportliche Erfolg steht über allem! Wenn sich „junge“ oder „Perspektivspieler“ entwickeln wird es gerne angenommen. Aber ist es das Ziel? Bei vielen Vereinen darf dies verneint werden. Solange aber Vereine Trainer auswählen, die ihren Aus- und Weiterbildungsauftrag nicht an- bzw. wahrnehmen geht die Seitwärts- oder Abwärtsspirale munter weiter.
Legionäre – Qualität vor Quantität
Das Thema „Legionäre“ oder „Imports“ ist seit Jahren ein Reizthema. Sind sie ein Hauptproblem an der aktuellen Lage oder muss das Thema in mehreren Aspekten betrachten werden?
In Wahrheit gibt es drei Gruppen von Ausländern in der Erste Bank Eishockey Liga: Spieler wie Lars Haugen, Nick Petersen (KAC), Chris DeSousa (Vienna Capitals), John Hughes (Red Bull Salzburg) oder ein Colton Yellow Horn (Graz99ers). Diese Cracks waren in der vergangenen Saison für ihre Mannschaften Leistungsträger und hatten einen gewaltigen Impact für ihre Mannschaft.
Danach kommt die überwiegende Menge der Mitläufer und auch jene, die in Wahrheit einfach „anwesend“ sind. Zu diesen beiden Gruppen ist eines zu sagen, meistens hat die Verpflichtung auch finanzielle Hintergründe. Viele Imports kommen mit einer Gage von rund, zum Teil sogar deutlich unter, 20.000 Euro nach Österreich. Spieler, welche sportlich nicht die benötigten Qualifikationen besitzen, ruinieren somit auch den wirtschaftlichen Markt für heimische Spieler. Das Thema Legionäre gilt es also auf mehreren Ebenen zu betrachten. Ein generelles Kurzfazit: Nicht alle sind gut, nicht alle sind schlecht! In einigen Fällen wäre aber mehr Qualität am Eis deutlich wünschenswert. Diese kostet aber Geld. Dazu später mehr.
Verband
Im Rahmen der Eishockey-WM 2011, übrigens ebenfalls in der Slowakei, sorgte Oliver Setzinger mit einer Aussage für Aufsehen. „Es ist immer leicht, von oben zuzusehen, im VIP-Raum Hors D’oeuvre zu essen und zu sagen, es fehlen die Leader“, sagte der damalige Nationalspieler über die Verbandsspitze. Der gebürtige Wiener wurde darauf hin aus dem Nationalteam gefeuert und nie mehr eingesetzt. Die Probleme im ÖEHV auch acht (!) Jahre danach sind die gleichen! Ohne echter Führung, ohne starken Auftritt, torkelt der ÖEHV am Rande der öffentlichen Wahrnehmung vor sich hin. Der Eishockey-Verband liegt seit Jahren im Dornröschenschlaf. „Freunderlwirtschaft“ und „Doppelfunktionen“ sind für viele „Funktionäre“ scheinbar noch immer wichtiger, als endlich im 21. Jahrhundert anzukommen.
Priorität auf den Nachwuchs setzen – Entwicklung einer österreichischen Philosophie
Ex-ÖEHV-Sportdirektor Alpo Suhonen wurde vorgeworfen, er hätte seinen Blick zu sehr auf seine Heimat Finnland geworfen. Bei Teamchef Roger Bader trifft selbiges zu. Mit dem Unterschied, dass der Schweizer ist. Man sollte bzw. hätte diesen Männern jedoch zuhören sollen. Beide Nationen erzeugen großartige Talente praktisch am Fließband. Ein Nico Hischier oder Kaapo Kakko sollte auch Ziel für das österreichische Eishockey sein.
Hier gibt es aber ein generelles Problem. Eine österreichische Philosophie ist aber auch nicht wirklich erkennbar. Aktuell weiß niemand wofür das österreichische Eishockey steht. Wofür stehen die Spieler? Was ist die Philosophie? Beschämend, dass dieser Aspekt seit Jahren unerledigt ist.
Ausbildungsprioritäten
Ausnahmetalente wie Kaapo Kakko wird es immer wieder geben. Spieler die an der Scheibe oder in Punkto Schnelligkeit außergewöhnlich sind, betreten praktisch im „2-Jahres-Intervall“ die große Eishockey-Bühne. Ein Trend wird immer auffälliger, die Talente werden immer handlungsschneller! Die Qualität ihrer Entscheidungen am Eis ist auf einem äußerst hohen Niveau!
Wer auf heimische Spieler blickt wird feststellen, dass hier großer Aufholbedarf besteht. Kaum ein Spieler schafft es aus der Nachwuchsabteilung, und ist in dem Bereich „sofort auf höchsten Erwachsenenniveau“ einsatzbereit. Dazu kommt, dass praktisch kein Talent körperlich „bereit“ ist. Wenn man Spielern, welchen mit Anfang 20 attestiert wird, dass er noch „10 kg Muskelmasse erarbeiten“ muss, gibt es Defizite in der Ausbildung! Dabei ist hier das längst fällige Thema „Skills-Coaches“ gar nicht erwähnt.
Aus- und Weiterbildung für Spieler – Netzwerke für die Karriere nach der Karriere
Ex-Fußball-Profi Manuel Ortlechner macht es mit seinem Projekt „Viola Fit“ vor. Aus- und Weiterbildung während und auch nach der aktiven Karriere ist für einen (Semi-)Profi von äußerster Wichtigkeit. Während so mancher Fußballer es schafft auszusorgen, müssen Eishockey-Spieler nach ihrer Karriere einen Beruf ausüben. Die Erste Bank Eishockey Liga sieht sich selbst auf Augenhöhe mit der Tipico Bundesliga. Wenn es um solche Aktionen oder gar um die Weiterentwicklung der Spieler geht, ist die Liga oder der Verband bestenfalls im „Ideen-Stadium“ unterwegs. Denn die einzige realistische Karriereoption für Spieler nach der aktiven Karriere ist Trainer! Da bewegt sich Liga und Verband in den 1980er-Jahren! Eishockey-Profis sind in der Regel sehr intelligente Männer. Die Vereine sollten dieses Wissen auch außerhalb des Eises nutzen!
Eishockey muss leistbar bleiben – für Eltern, Fans und die Vereine
Das österreichische Eishockey hat ein akutes Kostenproblem. Die wichtigsten Beteiligten stöhnen über die hohen Kosten. Die finanziellen Belastungen für Eltern von Spielern sind enorm. Programme, wie in anderen Ländern, gibt es in Österreich bestenfalls unterhalb der Wahrnehmbarkeitsgrenze. Zum Thema Kommunikation kommen wir noch später. Fans fordern seit Jahren, dass die Kosten sinken. Aber auch die Vereine raunzen. Ohne Mäzene ist (Semi-)professionelles Eishockey in Österreich nicht überlebensfähig. Sprich: An der Kostenschraube muss dringend justiert werden.
Schwache Öffentlichkeitsarbeit – Eishockey verkommt zu einer „Randsportart mit regionalen Spitzen“
Egal ob Liga oder Verband, die Öffentlichkeitsarbeit im österreichischen Eishockey ist ausbaufähig. Man sieht sich selbst als „Konkurrent“ von „König Fußball“. Die Wahrheit spricht eine andere Sprache! Es fehlt sowohl an Qualität sowohl auch Qualität in der Medienarbeit. Ein Beispiel: Eishockey schafft es nicht über die Saison gesehen signifikante Reichweite im Online-Bereich aufzubauen. Die Zahlen sprechen leider eine eindeutige Sprache.
Anm.: In der Grafik angeführt sind die heimischen Suchresultate im Überblick. Detailresultate entnehmen Sie bei „Google Trends“.
Phrasen sind genug gedroschen, große leere Ankündigen kann keiner mehr holen, lasst endlich Taten folgen!
Seit Jahren werden im österreichischen Eishockey Phrasen gedroschen. Wortspenden wie „Mehr Eishallen!“, „Wir benötigen mehr Nachwuchs!“, oder „Die besten Coaches für den Nachwuchs“ sind in Wahrheit nichts wert. Die Realität spricht eine andere Sprache. Kein (Lokal-)Politiker der halbwegs bei Verstand ist investiert Geld in eine Eishalle, die ein halbes Jahr ungenützt ist. Von einem Arenanutzungskonzept ist man, egal an welchem Standort, aktuell Lichtjahre entfernt. 300 bis 350 Kinder bringt der österreichische Nachwuchs heraus. Eishockey ist nicht nur in Österreich eine teure Sportart. So manche Eltern können und wollen sich dieses Hobby nicht leisten. Dazu kommt, dass bei dieser geringen Anzahl weder die benötigte Quantität noch Qualität vorhanden sein kann. Und das Thema bessere Coaches ist ein Reizthema. In Finnland hat jeder Eishockey-Trainer einen pädagogischen Abschluss. Davon ist man in Österreich meilenwert entfernt. Bei einigen Standorten in der Erste Bank Eishockey Liga trainiert gerade derjenige eine Mannschaft, weil „er da“ ist. Meist alleine! Dies ist so weit entfernt von einer hochwertigen Ausbildung, wie sie international üblich ist. Da ist es nicht verwunderlich, warum der heimische Nachwuchs zweit- oder drittklassig bei Weltmeisterschaften spielt. Wer aber diese Idealisten, die meist lachhaft gering entlohnt werden, an den Pranger stellt, der kritisiert an der falschen Stelle.
Auch von Funktionären sind immer wieder große Ankündigungen zu hören. Christian Feichtinger kündigte vor Saisonen an, dass die Statistiken NHL-Niveau erreichen würden. Die Wahrheit? In vielen Hallen stimmen Grundwerte, wie zB Daten zu Assists nicht! Bei der Eiszeitstatistik sitzen die – in Wahrheit eher schlecht bezahlten – Mitarbeiter nicht hinter den Spielerbänken, sondern in der Regel gegenüber. Dies hat zur Folge, dass Fehler passieren. Die Liga hält die Eiszeit-Statistik unter Verschluss! Mit Recht! Denn die Erhebungen sind grob fehlerhaft! Wenn aus dieser Statistik ein „Österreicher-Topf“ wie im Fußball finanziert werden würde (wie angedacht) darf dies als „höchst fragwürdige Sache“ angesehen werden.
Man sieht, gesprochen wird viel, Taten hinter diesen Worten sind nicht vorhanden! Die Sporartart Eishockey, mit seiner langen Historie in Österreich, hätte dies definitiv verdient!
Fazit
An dieser Stelle kann man es kurz und schmerzhaft machen. Die Baustellen im österreichischen Eishockey sind seit Jahren bekannt und allgegenwärtig! Wenn Dinge umgesetzt werden, grenzt es an blinden Aktionismus, der an den vorhandenen Problemen nichts ändert. Nicht mehr, nicht weniger. Substanzielle Reformen, die in Wahrheit seit Jahren überfällig sind, sind nicht in Sicht! Eishockey in Österreich dreht sich im Kreis! Alles nur an Legionären festzumachen ist billig und eine faule Ausrede wie das Beispiel Deutschland beweist. In der DEL stehen ähnlich viele Ausländer auf dem Eis, und Deutschland stand im Viertelfinale der WM. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Ob es Taten gibt, darf bezweifelt werden. Unbequeme, längst überfällige Reformen werden aufgeschoben und nicht angegangen.Warum wird nicht gehandelt? Weil Freundschaften und persönliche Eitelkeiten wichtiger sind als Verbesserungen an der Sache! Dieser harten Wahrheit gilt es knallhart ins Auge zu sehen.
01.06.2019