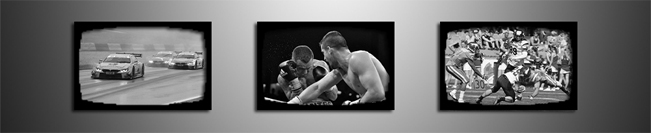Es war die 50. Minute im Spiel GAK gegen Austria Wien, als die Emotionen hochkochten. War der zurückgenommene Handelfmeter für Austria Wien nun ein Fehler des Schiedsrichters, des VAR – oder hätte die Entscheidung am Rasen bleiben müssen? Die Szene legt zwei grundlegende Probleme im österreichischen Schiedsrichterwesen offen, ein weiteres im Sportjournalismus – und ein gravierendes für Medienbetreiber. Ein Kommentar von Thomas Muck.
War es ein Elfmeter oder keiner? Ist die Regel so formuliert, dass hitzige Diskussionen unausweichlich sind? Fragen über Fragen! Fakt ist: Die Entscheidung von Schiedsrichter Ebner führte genau dazu.
Auf der Heimfahrt von einem anderen Bundesligaspiel griff ich zum Telefon und kontaktierte vier Regel-Experten. Zwei meinten, es sei klar kein Elfmeter. Einer argumentierte, der Strafstoß wäre aufgrund der Handhaltung durchaus gerechtfertigt gewesen. Der vierte sagte, ihn interessiere vor allem die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR – denn die könnte alles aufklären. Vier Telefonate – und man ist genauso schlau wie vorher.
Das zeigt zwei Kernprobleme im österreichischen Schiedsrichterwesen.
Eines vorweg
Die heimischen Schiedsrichter sind nicht so schlecht, wie ihr (nationaler) Ruf vermuten lässt. Aber sie sind auch (noch) nicht so stark, dass man sie ins internationale Spitzenfeld reiht. Auf europäischer Ebene sind sie: gehobener Durchschnitt! Es gibt Qualität und talentierten Nachwuchs, auf den man aufbauen kann.
Es gibt positive wie negative Punkte. Über erstere (wie etwa die Leistung von Schiedsrichter Hameter bei Rapid – Blau Weiß Linz) wird allerdings kaum gesprochen. Das ist zum Teil das Los eines Schiedsrichters.
Kritik, wenn angebracht, habe ich immer geäußert und werde das auch weiter tun. Aber bleiben wir bei den Fakten: Qualität ist da – in zwei Punkten muss jedoch dringend nachgeschärft werden.
Problem 1: Kommunikation
Schiedsrichter kommunizieren selten bis nie offiziell mit Journalisten. „On record“-Statements? Fast null. Eine Einstellung, die man in Teilen nachvollziehen kann: Nicht jeder Journalist ist an der Sicht des „dritten Teams am Rasen“ interessiert. Lieber wird „die eigene Meinung von oben herab auf Leser und Kollegen heruntergerotzt“.
Auf der anderen Seite: Wer lässt sich schon gern „wie eine Sau durchs mediale Dorf treiben“? Ein silenzio stampa ist daher verständlich.
Aber es ändert nichts am Kernproblem: Wie kam es zu einer diskutablen Entscheidung, wie eben am Sonntag?
Solange diese Kommunikation fehlt und vorgesehene Kanäle nicht genutzt werden, sinkt das Ansehen weiter. Das ist kontraproduktiv.
Unbequeme Fragen zum Status quo sind definitiv erlaubt. Beispiele:
• In anderen Ligen verkünden Schiedsrichter das Ergebnis des On-Field-Review via Stadionmikrofon. Warum nicht in Österreich?
• Wann erhält der VAR-Account auf X eine Strategie, um Fans zu informieren?
• Warum hat man in den Vorsaisonen tatenlos zugesehen und die Antwortfunktion Trollen und „weiteren chronisch negativen Elemente“ überlassen?
• Warum haben weder ÖFB noch Bundesliga aus der Gishammer-Causa Konsequenzen gezogen? Die Schutzfunktion dem Schiedsrichter gegenüber sieht man höchstens beim vierten oder fünften Hinsehen – und auch nur am Rande.
Diese Liste ließe sich übrigens noch länger fortsetzen …
Aber bleiben wir beim Kern: Um „Verschwörungsmythen oder ähnliche Dummheiten“ zu entkräften, wäre es sinnvoll gewesen, die interne Kommunikation innerhalb des Schiedsrichterteams offenzulegen. Da gäbe es Antworten auf Grundfragen wie: Wie kam es zur VAR-Intervention und der Erkenntnis, dass es sich um eine vermeintliche Fehlentscheidung handelt? Das wäre informativ und lehrreich – für die Öffentlichkeit ebenso wie für zukünftige Schiedsrichter. Die logische Schlussfolgerung die auf der Hand liegt: Wer aus der Gegenwart nicht lernt bzw. keine Rückschlüsse zieht, wird die Zukunft nicht verbessern.
Gleichzeitig muss das Thema VAR-Intervention und deren Auslegung kritisch beleuchtet werden. Die jüngere Vergangenheit zeigt: Es gab Interventionen, die nicht angebracht waren – und umgekehrt. Fußballfans sind Konsumenten. Sie geben Geld für Tickets, TV-Abos, Fanartikel etc. aus. ÖFB, Bundesliga und auch die Schiedsrichter sind diesen Kunden Transparenz schuldig.
Ein Statement, auf der eigenen VAR-Homepage welches nicht als Pressemitteilung ergeht, rund 24 Stunden nach dieser Situation ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist unzureichend, es ist einfach zu spät. Einen nicht moderierten Shitstorm (im schlechtesten Fall, Anm.) „einfach zur Netz laufen lassen“ ist keine Kommunikationsstrategie, es ist eher ein „Kopf in den Sand stecken“. Es wirkt wie eine Aufgabe, dabei ist Kommunikation, wie in allen Lebenslagen ein wichtiger Schritt.
Wer hier übrigens die Schuld bei den aktiven Schiedsrichtern sucht, sieht den falschen Schuldigen. Egal, mit welchen Unparteiischen oder Zurückgetretenen ich in den letzten 24 Monaten sprach – alle wären sofort für Offenlegung zu haben gewesen. Bremsen hier die Funktionäre?
Kommen wir damit zum zweiten Problem.
Problem 2: Regelwerk und Auslegung
Was ist ein Handspiel – und was nicht? Diese Diskussion gibt es seit Jahrzehnten, und sie wird bleiben. Generell gilt: Je größer der Interpretationsspielraum, desto weniger einheitlich die Linie. Die Regelhüter machen es den Schiedsrichtern unnötig schwer. Dazu kommt die Öffentlichkeit, die aus berechtigten Gründen, eine durchgehende Regelhandhabung einfordert. Gab es diese in bestimmten Regeln in der jüngeren Vergangenheit? Die Antwort ist ein eindeutiges: Jein!
Die österreichischen Unparteiischen werden ihre internationalen Bosse kaum kritisieren. Sie setzen das vorhandene Regelwerk um. Sei es auch teilweise noch so suboptimal für die eigene Position/Funktion auf dem Rasen. Hier ist der Journalismus gefragt, der das unglückliche Agieren des IFAB und dessen mangelnde Kommunikation thematisieren muss.
Auch hier gibt es wieder viele Fragen: Bsp.: Warum wird nicht mit interessierten Medien gesprochen? Warum keine Infoevents für die Presse, damit Journalisten ihre Verantwortung wahrnehmen können?
Kann man Professionalität von Medienvertretern verlangen, wenn man selbst nichts anbietet?
Aber hier kommen wir zu einem weiteren Aspekt der aktuellen Situation.
Sportjournalismus am Scheideweg
Vor Ort ist man als „aktiver Stadionberichterstatter“ ein sprichwörtlich armer Hund. War es Elfer oder nicht? Selten gibt es sofort eine klare Antwort.
Mit einem grundsätzlichen „Vielleicht, aber …“-Gefühl in die Mixed Zone oder Pressekonferenz zu gehen, ist unbefriedigend – für das eigene Medium, das veröffentlichte Produkt und somit auch für den Journalismus bzw. dem Konsumenten, dem Leser.
Wir schreiben 2025, und der User hat ein Recht auf schnelle Fakten. Bekommt er sie? Nein. Inhaltlicher Frust ist dementsprechend nachvollziehbar.
Der Sportjournalismus steht 2025 generell am Scheideweg: Wenige Vollzeitstellen, KI bedroht weitere Jobs (wenn Sie wüssten … ). „Hot Takes“ und „von oben herabrotzen“ sind kein Journalismus, stehen aber an der Tagesordnung.
Aber mal generell gefragt: Wird er überhaupt noch gewollt – oder machen wir künftig PR? Oft wird einfach nur noch das eigene Klientel, das eigene Ego bedient. Das eben kein Journalismus. Click- oder Ragebait auch nicht!
Meine Definition: Journalismus muss Dinge aufzeigen, den Finger in die Wunde legen. Tun wir das? Klares Nein! Diese Worte sind also auch Eigenkritik des Autors.
An der Stelle ein generelles Fazit:
Hört auf, direkt Schiedsrichter anzumotzen. Kritisiert die fehlende Kommunikation und die (zum Teil) sehr schwierigen Rahmenbedingungen, die sie in solche Situationen bringen. Macht die erwähnten kritischen Fragen (und ja, hier gehört auch die Debatte um Kamerapositionen für den VAR dazu) zum Thema – und nicht sofort primär den Unparteiischen.
Und die Medienbetreiber – Sind sie „Mitschuld an der Situation“?
Wer Kommentarspalten liest (schuldig, ich habe einige in Vorbereitung überflogen) oder manche Artikel, erkennt: Es gibt systemische Probleme! In Österreich herrschen Clickbait, Hot Takes, Trolle, Arroganz und zum Teil fehlende Moderation. Der Schutz der eigenen, oft rasch abwandernden Klientel ist wichtiger als journalistische Grundsätze. Nach den jüngsten Entscheidungen bei der Medienförderung ist es sogar nachvollziehbar. Aber völlig kontraproduktiv!
Die Branche steht vor Umbrüchen – Eigentümerwechsel hier, strukturelle Änderungen dort. Entwicklungen, die in den USA vor Jahren begannen, erreichen Europa.
Verstehe ich als akkreditierter Journalist und ehemaliger Medienbetreiber daher Schiedsrichter, die sich dieser medialen Maschine entziehen? Oh ja!
Löst das die Probleme? Nein! Die Katze beißt sich also weiter in den Schwanz – und die nächste Diskussion kommt bestimmt. Wieder werden Schiedsrichter und VAR heftig kritisiert. Dabei sind sie „nur das schwächste Glied“ in einem System mit vielen systematischen Fehlern.
Also bis zum nächsten Vorfall. Ich muss dann nur Paarung, Spielminute und Schiedsrichter ändern – um denselben Kommentar erneut zu posten. Wie in einem bekannten Hollywood-Film:
Und täglich grüßt das Murmeltier – nur im Wochen- oder Monatsrhythmus.
Der ÖFB und die Bundesliga müssen endlich den Mut haben, mehr Transparenz zu zeigen: Kommunikation im Schiedsrichterwesen der VAR-Entscheidungen veröffentlichen, klare Medien und Social-Media-Strategie und zum Bsp. Info-Events für Medien. Solange das nicht passiert, drehen wir uns weiter im Kreis – und die Glaubwürdigkeit – der österreichischen Schiedsrichter – bleibt auf der Strecke.
04.08.2025